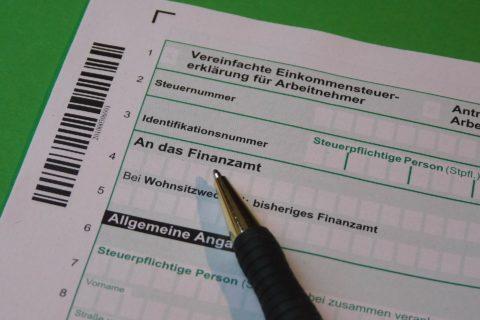Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist davon auszugehen, dass ein Teilnehmer an einem sportlichen Kampfspiel grundsätzlich Verletzungen in Kauf nimmt, die auch bei regelgerechtem Spiel nicht zu vermeiden sind. Ein Schadensersatzanspruch gegen einen Mitspieler setzt daher voraus, dass dieser sich nicht regelgerecht verhalten hat.

Verletzungen, die auch bei sportgerechtem Verhalten auftreten können, nimmt jeder Spielteilnehmer in Kauf. Deshalb verstößt es jedenfalls gegen das Verbot des treuwidrigen Selbstwiderspruchs, wenn der Geschädigte den beklagten Schädiger in Anspruch nimmt, obwohl er ebensogut in die Lage hätte kommen können, in der sich nun der in Anspruch genommene befindet.
Es wird daher ein Haftungsausschluss bei sportlicher Betätigung für den Fall angenommen, dass kein oder kein gewichtiger Regelverstoß bzw. kein grob fahrlässiges Verhalten des Schädigers feststellbar ist. Bei Wettkämpfen mit nicht unerheblichem Gefahrenpotential, bei denen typischerweise auch bei Einhaltung der Wettkampfregeln oder geringfügiger Regelverletzung die Gefahr gegenseitiger Schadenszufügung besteht, ist von einem konkludenten Haftungsausschluss auszugehen[1].
Fußball ist eine solche Sportart. „Fußball ist ein Kampfspiel, d.h. ein gegeneinander aus-getragenes „Kontaktspiel” – bei dem es also zu körperlichen Berührungen kommt, das unter Einsatz von Kraft und Geschicklichkeit geführt wird und das wegen des dieser Sportart eigenen kämpferischen Elementes bei dem gemeinsamen „Kampf um den Ball” nicht selten zu unvermeidbaren Verletzungen führt. Mit deren Eintritt rechnet jeder Spieler und geht davon aus, dass auch der andere diese Gefahr in Kauf nimmt, daher etwaige Haftungsansprüche nicht erheben will. Ein dieser Spielordnung etwa entgegenstehender innerer Vorbehalt eines Spielers wäre rechtlich unbeachtlich; denn die Rechtsbeziehungen der an einem Fußballspiel Beteiligten müssen schadensrechtlich in ihrer objektiven Typizität bewertet werden, so dass es auf die individuelle Haltung des jeweiligen Spielers nicht ankommt.“[2]. „Welche Gefahren im einzelnen hingenommen werden müssen, bestimmt sich in erster Linie nach den Spiel-regeln, nach denen die Sportmannschaften angetreten sind. Handelt es sich wie hier um ein Fußballverbandsspiel, so bieten, wovon das Berufungsgericht zutreffend ausgeht, die Fußballregeln des Deutschen Fußballbundes das entscheidende Erkenntnismittel für das Ausmaß des mit dem Spiel eingegangenen und übernommenen Risikos. Diese Regeln verfolgen zwar in erster Linie den Zweck, die Eigenheiten des Spiels zu prägen, den Spielfluss sowie Chancengleichheit zu gewährleisten und durch bestimmte Sanktionen einen Ausgleich für regelwidrig erlangte Vorteile herzustellen. Jedoch sollen sie auch das dem Spiel eigene kämpferische Element mit dem notwendigen Schutz von Leben und Gesundheit der Spieler in Einklang bringen und verhindern, das gefährliches Spiel, Rohheiten und unsportliches Verhalten zu Verletzungen führen. Darum enthalten sie auch Regeln darüber, welche Handlungen zum Schutze der Spieler nicht erlaubt sind. Die Regeln mögen nicht erschöpfend, deshalb gegebenenfalls durch Entwicklung weiterer Sportpflichten zu ergänzen sein[3]. Dennoch bieten die Generalklauseln des „Spielens in gefährlicher Weise”, des „unsportlichen Betragens” und des „rohen Spiels” (s. Regel 12 Abs. II, III und IV) i.V. mit den einzeln aufgeführten, dem Schutz der Spieler dienenden Verboten einen wichtigen Maßstab dafür, was als spielordnungsgemäßes Verhalten anzusehen ist und wo nach dem Willen der Spieler die Grenze des Erlaubten überschritten wird, so dass einem Verlangen nach Schadensersatz nicht mehr der Gedanke des Selbstwiderspruches entgegenstände.“[4]. Das Gericht geht zudem auch davon aus, dass die Freistellung des Verletzers auch dann gelten muss, wenn er zwar geringfügig gegen eine dem Schutz der Spieler dienende Regel verstoßen hat, dies aber aus Spieleifer, Unüberlegtheit, technischem Versagen, Übermüdung und dergleichen geschehen ist[5].
Die Regel 12 der Fußballregeln des Deutschen Fußballbundes bestimmen unter Nr. 1, dass ein direkter Freistoß bei Vergehen mit Körperkontakt wie z. B. Anspringen, Treten, Tackling mit dem Fuß oder Angriffen mit einem anderen Körperteil zu ahnden ist. Dabei wird zwischen fahrlässigem, rücksichtslosen und brutalen Vorgehen weiter differenziert. Fahrlässigkeit ist anzunehmen, wenn ein Spieler unachtsam, unbesonnen oder unvorsichtig in einen Zweikampf geht. In solchen Fällen ist keine Disziplinarmaßnahme erforderlich. Rücksichtslosigkeit liegt vor, wenn ein Spieler ohne Rücksicht auf die Gefahr oder die Folgen für den Gegner handelt. In diesen Fällen ist eine Verwarnung vorgesehen. Brutales Spiel liegt nach dieser Regel vor, wenn ein Spieler übertrieben hart vorgeht und die Sicherheit eines Gegners gefährdet. In diesen Fällen ist der Spieler des Feldes zu verweisen. Unter Nr. 2 der Regel 12, die regelt, wann ein indirekter Freistoß zu geben ist, wird bestimmt, dass als gefährliches Spiel jede Aktion gilt bei dem Versuch, den Ball zu spielen, durch die jemand verletzt werden könnte.
Vor dem Hintergrund dieser Voraussetzungen konnte im hier entschiedenen Fall vom Landgericht Kiel eine haftungsbegründende Verletzungshandlung des Beklagten aufgrund der Beweisaufnahme nicht zur Überzeugung des Gerichts festgestellt werden. Die Beweisaufnahme nicht ergeben, dass der Beklagte durch eine grob regelwidrige Handlung den Kläger verletzte. Das Gericht geht dabei davon aus, dass eine Haftung nach den dargelegten Maßstäben nur dann in Betracht kommt, wenn festgestellt werden kann, dass der Spieler brutal im Sinne der Regel 12 Nr. 1 gespielt hat. Dass der Beklagte bei seinem Spielzug gehandelt hat, hat die Beweisaufnahme nicht zur Überzeugung des Gerichts ergeben. Dass der Kläger durch die Spielweise des Beklagten so schwer verletzt wurde und der Schiedsrichter dies mit der roten Karte geahndet hat, reicht als Indiz für eine so schwerwiegende Spielweise, dass sie als brutales Spiel einzuordnen wäre mit der Folge, dass der Beklagte dafür haften müsste, allein nicht aus. Das Gericht konnte nicht ausschließen, dass der Beklagte aus Spieleifer, Unüberlegtheit und/oder technischem Versagen den Kläger so unglücklich und so schwer verletzt hat. Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass der Beklagte versucht hat, im Wettlauf mit dem Kläger an den Ball zu gelangen. Dabei kam der Kläger etwa vom rechten Flügel der gegnerischen Mannschaft in Richtung Mittelfeld gelaufen, der Beklagte kam aus dem Bereich vor der Mitte des Tores seiner Mannschaft ebenfalls in Richtung Mittelfeld. Der Beklagte nahm während des Laufens im Augenwinkel den Kläger war. Er musste dabei feststellen, dass der Kläger schneller war und den Ball allein durch Laufen daher vor ihm erreichen konnte. Deshalb setzte er, um den Ball schneller zu erreichen, zum Grätschen an. Auf diese Weise flog er in Richtung des Klägers, der inzwischen auf dem rechten Bein stand und mit dem linken den Ball angenommen hatte, und traf diesen am rechten Unterschenkel, der hierdurch brach. Nicht festgestellt werden konnte, dass der Beklagte für den Kläger von hinten kam. Vielmehr befanden sich die Parteien im Lauf in einem gewissen, nicht näher feststellbaren Winkel zueinander, sodass der Beklagte den Kläger von der Seite am rechten Unterschenkel traf. Soweit der Beklagte in seiner Anhörung angegeben hat, dass er mit seinem rechten, also seinem Spielbein, den Ball getroffen, und mit seinem linken Schienbein gegen das rechte Bein des Klägers geschlagen sei, an dem er selbst eine Prellung neben dem Schienbeinschoner erlitten habe, hat die Beweisaufnahme nicht zur Überzeugung des Gerichts ergeben, dass das anders war, insbesondere, dass der Beklagte mit seinem Spielbein anstelle des Balls den Unterschenkel des Klägers getroffen hat. Wie genau der Beklagte den Kläger getroffen hat, konnte keiner der vernommenen Zeugen angeben. Es konnte auch nicht hinreichend sicher festgestellt werden, dass der Beklagte beim Grätschen mit gestrecktem Bein und offener Sohle direkt auf den Unterschenkel des Klägers hinzu gesprungen ist. Der Schiedsrichter hatte eine bildhafte Erinnerung nur noch an den offenen Bruch, den er damals als einer der ersten gesehen hat. Diese bedeutende Erinnerung begründet sich nachvollziehbar in dem schockierten Gefühl auch dieses Zeugen. Im Übrigen konnte er noch wiedergeben, dass der Beklagte angegrätscht gekommen sei. Soweit er auf die Frage, ob er noch sagen könne, wann er erstmals an die rote Karte gedacht habe, gesagt hat, dass das gewesen sei, als er den verletzten Fuß gesehen habe, wertet dies das Gericht eher als ein Indiz dafür, dass er von der schweren Verletzung auf die besondere Vorwerfbarkeit des Spielzuges im Nachhinein geschlossen haben könnte. Hierfür spricht auch, dass er auf entsprechende Frage angegeben hat, dass das Spiel zunächst nach Ballspielen ausgesehen habe. Soweit der Schiedsrichter auf Nachfrage angegeben hat, dass er der Meinung sei, dass der Beklagte bei der Grätsche gestreckte Beine gehabt habe und auch eine sogenannte offene Sohle, d. h. mit der Sohle gegen den gegnerischen Spieler gerichtet gewesen sei, vermochte sich das Gericht nicht davon zu überzeugen, dass sich dies tatsächlich so ereignet hat. Denn auf Vorhalt der Angaben in seiner polizeilichen Vernehmung etwa 3 Monate nach dem Spiel hat er wiederum angegeben, dass es auch sein könne, dass der Beklagte den Ball habe spielen wollen. Soweit er in diesem Zusammenhang beschrieben hat, dass der Beklagte mit sehr viel Dynamik und übertrieben sich eingesetzt hat, kommt es ebenfalls in Betracht, dass der Beklagte aus Übereifer sich mit seinem ganzen Körpergewicht so eingesetzt hat, dass er dies unglücklicherweise nicht mehr unter Kontrolle hatte. Auch der Co-Trainer, der am Spielfeldrand saß und die Szene nachvollziehbar recht genau beobachtet hat, konnte nur bestätigen, dass der Beklagte den Kläger, als dieser gerade nur auf dem rechten Bein stand, weil er mit dem linken Fuß gerade den Ball annehmen wollte, am Standbein getroffen habe. Womit der Beklagte den Kläger traf, konnte der Co-Trainer hingegen nicht angeben. Nachvollziehbar hat er beschrieben, dass er in dem Moment, als der Beklagte die Grätsche angesetzt hat, für sich erkannt habe, dass das gleich ein schwerer Kontakt werden würde, weil der Beklagte viel Tempo draufhatte. Das bestätigt jedoch nur die erhebliche Dynamik, die der Beklagte hatte, nicht die Zielrichtung seines Körpereinsatzes. Obwohl der Co-Trainer die Szene genau beobachtete, konnte er nicht sagen, ob das Bein des Beklagten gestreckt oder angewinkelt war und ob der Beklagte mit geöffneter Sohle ankam. Zudem hat der Co-Trainer die Szene in der Weise beschrieben, dass eine solche hier eingesetzte Härte in gewissen Zweikampfphasen normal sei, üblicherweise aber nicht am Mittelkreis, sondern eher beim Stürmen in Richtung des Tores. Das beschreibt aber eine Vorgehensweise eines Spielers, mit der grundsätzlich während des Fußballspiels noch gerechnet wird. Der Zeuge A., der Mitspieler des Beklagten war, hat ebenfalls bestätigt, dass der Beklagte beim Lauf um den Ball langsamer als der Kläger gewesen sei. Er hat dann aber beschrieben, dass die Beine des Beklagten eher gekrümmt gewesen seien. Als Geräusch habe er das übliche Aufeinandertreffen von Schienbein auf Schienbein sowie den anschließenden Schrei des Klägers gehört. Der Zeuge C., der Mitspieler des Klägers war und von diesem ein Zuspiel des Balles erwartete, hat ebenfalls bestätigt, dass der Beklagte beim Laufduell langsamer gewesen sei und dass der Kläger, weil schneller als der Beklagte, kurz vor dem Zusammenstoß den Ball gerade noch habe stoppen können. Er hat aufgrund seiner Kenntnis, dass der Kläger ein sogenannter Linksfuß ist, angenommen, dass dieser in dem Moment auf dem rechten Bein gestanden habe. Details über den Zusammenstoß konnte er auch nicht wiedergeben. Soweit der Zeuge C. angegeben hat, dass er meine, dass der Beklagte nicht mehr die Möglichkeit gehabt habe, den Ball zu spielen, weil er von der rechten Seite kam und der Ball beim Kläger schon am linken Fuß gewesen sei, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Zeuge aufgrund seiner Kenntnisse über den Spielfuß des Klägers hier einer nachträglichen Schlussfolgerung unterlegen ist. Jedenfalls kann aufgrund dieser Unklarheit der Details des genauen Ablaufs nicht festgestellt werden, dass für den Beklagten schon beim Ansetzen zur Grätsche hätte klar sein müssen bzw. möglicherweise sogar klar war, dass er den Ball nicht würde erreichen können und er die Gesundheit des Klägers durch seine Spielweise erheblich gefährdet. Reichen die Feststellungen hiernach nur für die Annahme eines fahrlässigen und übertrieben heftigen Spielzuges aus, kommt nach den oben dargelegten Grundsätzen eine Haftung des Beklagten nicht in Betracht.
Landgericht Kiel, Urteil vom 18. September 2019 – 13 O 66/19
- vgl. hierzu insgesamt BGHZ 154, 316 = NJW 2003, 2018[↩]
- BGH NJW 1975, 109 Juris-Rn. 8[↩]
- vgl. Schroeder-Kauffmann, Sport und Recht S. 26[↩]
- ders., a. a. O., Rn. 14[↩]
- offengelassen bei BGH, a. a. O., Rn. 15 m. w. Nachw., s. a. Wagner in MünchKomm, 7. Aufl., § 823 Rn. 695[↩]
Bildnachweis:
- Fußball: Michal Jarmoluk